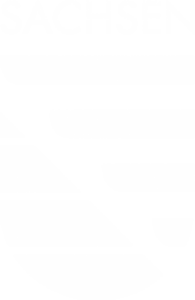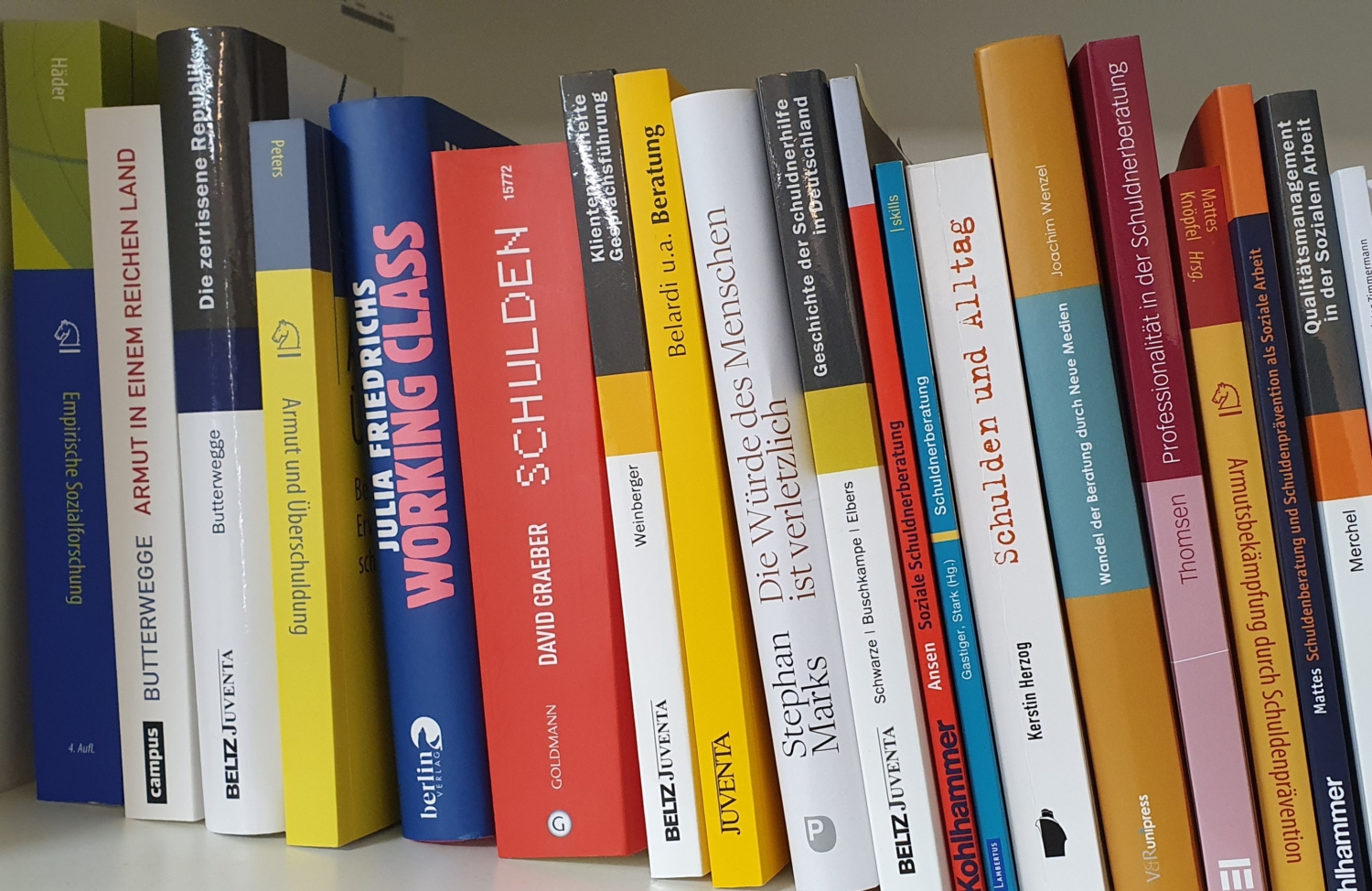Digitalisierung in der Schuldnerberatung
Als nach der ersten Welle der Corona-Pandemie im späten Frühjahr 2020 persönliche Beratung wieder möglich war, wurde sie von den meisten Beratungsstellen in Sachsen (mit Ausnahme der offenen Sprechstunden) umgehend wieder angeboten. Es hatte sich herausgestellt, dass eine online-Beratung oder eine Beratung per Telefon unter Umständen viel anstrengender und komplizierter war als eine persönliche. Unsicherheit herrschte insbesondere auch im Bereich der einzuhaltenden Vorgaben des Datenschutzes.
Was aber hat die erste vorübergehende Unmöglichkeit persönlicher Beratung an positiven Effekten für die Weiterentwicklung der Schuldnerberatung gebracht? Hat sie gezeigt, wo die Schuldnerberatung im Hinblick auf die unausweichliche zunehmende Digitalisierung aller Lebens- und Arbeitsbereiche steht? Ist offenbar geworden, ob und wenn ja welche Mängel in der technischen Ausstattung und in den Ressourcen der Beratenden und Ratsuchenden bestehen? Ist ein Prozess der Auseinandersetzung mit Fragen der Digitalisierung auf Seiten des Arbeitgebers angeregt oder befeuert worden, bis hin zu Investitionen in technische Ausstattung? Haben sich mögliche Zukunftsperspektiven herausgeschält, die man ohne die Zwangspause gar nicht erkannt hätte?
Vor dem Hintergrund der weiteren Entwicklung (und nicht nur der corona-bedingten) scheint es ratsam, sich intensiv mit Digitalisierungsprozessen in der Schuldnerberatung zu befassen. Unterstützung hierzu bietet auch ein Beitrag von Dr. Sally Peters, Institut für Finanzdienstleistungen (iff), im Überschuldungsradar 20/August 2020: „Digitalisierung in der Schuldnerberatung: Wo stehen wir? – Praxis und Perspektiven -“
Die Verfasserin betont die notwendige und zukunftsweisende Beschäftigung mit dem Thema der Digitalisierung in der Schuldnerberatung. Die Digitalisierung in diesem Bereich ist dabei nicht gleichzusetzen mit oder beschränkt auf Online-Beratung sondern betrifft darüber hinaus viele Aspekte wie: Software, Monitoring und Dokumentation, Kommunikation, interne Organisationsprozesse u.a. Der Beitrag ist stellenweise wie ein Weckruf an die soziale Arbeit. Wenn die Akteurinnen der sozialen Arbeit es verpassen, sich selbst mit der Digitalisierung zu beschäftigen, würde sie ihnen irgendwann möglicherweise aufgezwungen.
Ausgehend vom aktuellen Stand, der vielerorts von großer Zurückhaltung gegenüber der Digitalisierung geprägt sei, erläutert sie, dass Digitalisierung und Arbeitsgrundsätze sozialer Arbeit nicht im Gegensatz zueinander stehen. So blieben zentrale Arbeitsprinzipien wie „Vertrauen, Menschenbild, Zeit, Ergebnisoffenheit, Individualität der Ratsuchenden und Motivation, Erschließung der Ressourcen etc.“ erhalten. Die Autorin verschließt nicht die Augen vor den Herausforderungen, die sich im Zuge der Digitalisierung ergeben. Neue Arbeits- und Organisationsformen zu etablieren, bedeutet Veränderung, die durch Unsicherheit und fehlende Erfahrung zunächst Widerstand hervorrufen kann. Auch wenn es große Ungleichheit hinsichtlich digitaler Zugänge gibt, sei doch der digitale Wandel bei Ratsuchenden längst angekommen.
Schließlich unternimmt die Autorin den Versuch, eine Digitalisierungsstrategie für die Schuldnerberatung zu entwickeln, die auf verschiedenen Prozessebenen ansetzt. Weil die Finanzierungsvorgaben im sozialen Bereich eher eng sind, eine Aufrüstung im Sinne der Digitalisierung aber mit Kosten verbunden ist, muss der Ausgangspunkt immer eine Analyse konkreter Ziele und Schwerpunkte der Einrichtung sein.
Der komplette Beitrag ist auf der Seite des iff zu lesen: https://www.iff-hamburg.de/ueberschuldungsradar/